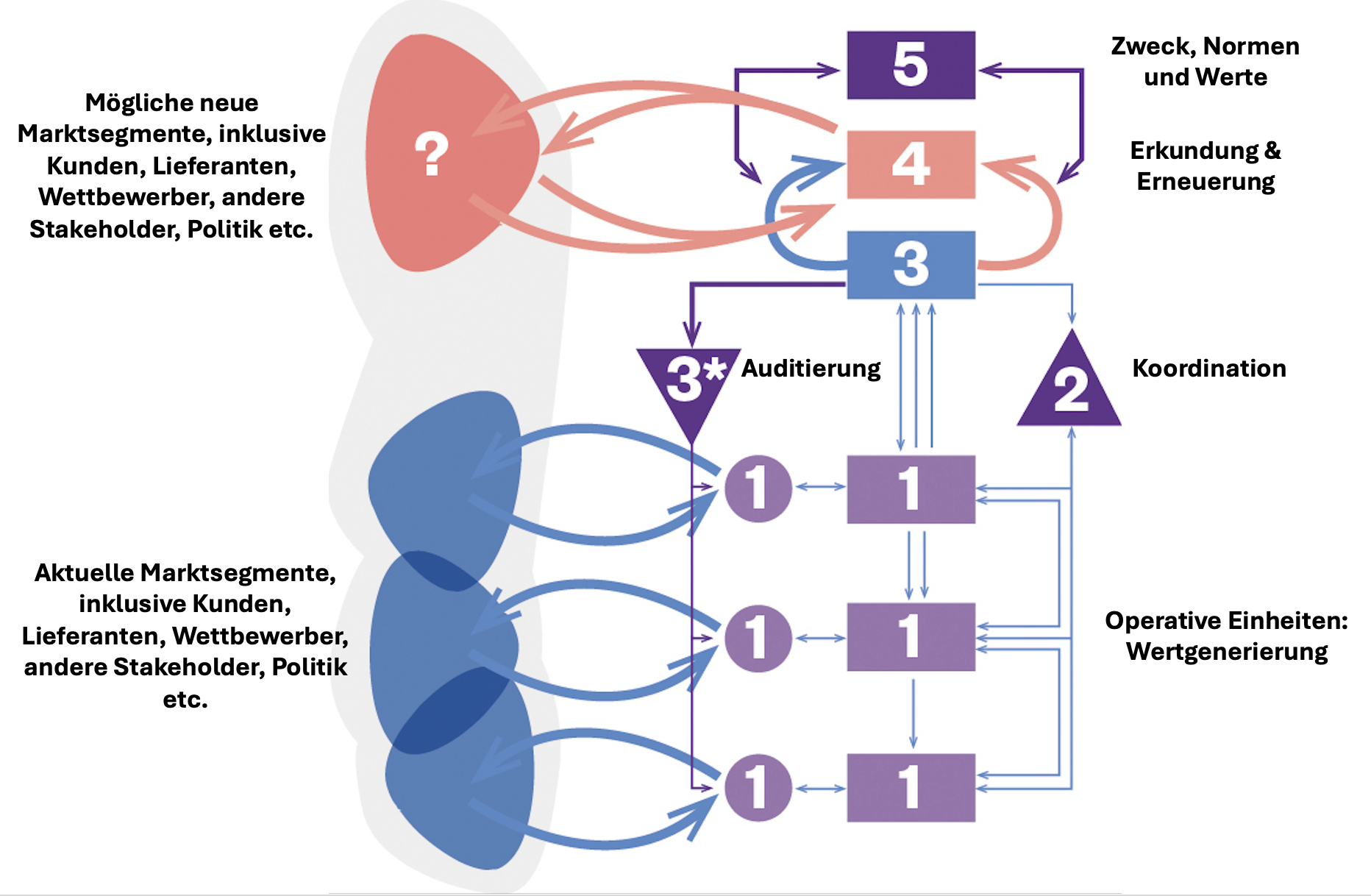Conny Dethloff
Conny Dethloff ist im Jahr 1974 geboren und hat sein Studium als diplomierter Mathematiker 1999 abgeschlossen. Direkt im Anschluss ist er in die Wirtschaft aktiv eingestiegen, bis 2011 als Unternehmensberater bei PwC und IBM Deutschland GmbH, von 2012 bis 2020 als Senior Manager im Bereich Business Intelligence bei der OTTO GmbH & Co KG. Nun ist Dethloff wieder Berater bei emergize GmbH & Co KG und berät Unternehmen bei ihren Transformationen und Restrukturierungen.
Teilen
Aktivitäten
Kontakt & Informationen
E-Mail: c.dethloff@emergize.org
Telefon: +49 151 171 53 115
Am Dorfkrug 11
18211 Admannshagen
Inhalte auf der LeanBase
LeanDownloads
Wer folgt Conny Dethloff?
4 Nutzer folgen Conny Dethloff.
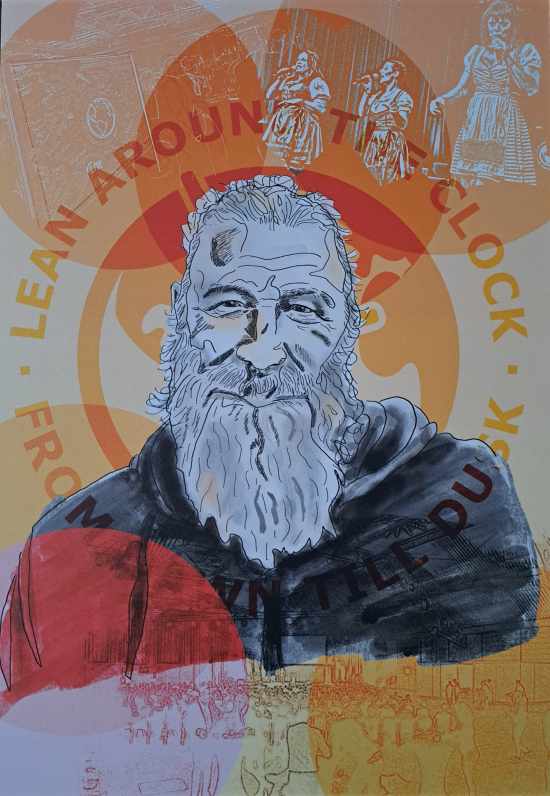
Ralf Volkmer
Wer besser werden will, braucht Zeit um besser zu werden. Wer keine Zeit hat wird halt nicht besser!

Angela Fuhr
Ich möchte gemeinsam mit meinen Kolleg:innen dazu beitragen, dass das Gedankengut des LeanManagement eine breite Öffentlichkeit findet. Daher lade ich alle dazu ein, unsere Angebote und Möglichkeiten, die wir mit der LeanBase geschaffen haben, zu nutzen, ob als Anbieter, Nachfrager oder Interessierter - von Auszubildenden, Studentinnen und Studenten, Mitarbeitenden vom Shopfloor oder dem...
Florian
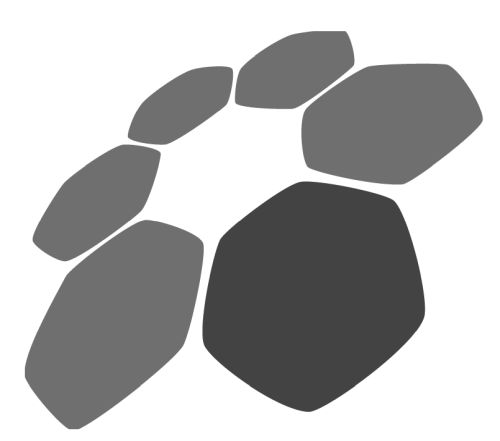
LeanBase
Wir sind Deine Suchmaschine, Wissensquelle und Community-Plattform für Alles, was sich mit Geschäftsprozessen in Unternehmen und Organisationen beschäftigt. Von A wie Agil bis Z wie Zielableitung findest Du bei uns fundiertes und praxiserprobtes Fach-Knowhow von Expert:innen in Text, Bild und Video.
Weitere Inhalte
Kennst Du schon LeanMarketPlace?
-
Angebote unterschiedlichster Anbieter von A-Z
-
Platziere Dein eigenes Angebot hier
-
Finde geeignete Angebote für Dein LeanProjekt

Training Within Industry – TWI
Die Wurzel des Lean Management & des Toyota Production System. Die wichtigsten Bedürfnisse von Führungskräften an der Basis erfüllen: Die Fähigkeit zur Schaffung von Arbeitsstandards, zur Schaffung guter Arbeitsbeziehungen und kontinuierlichen Verbesserung – Praxisorientiert & bewährt

Lean, Kaizen, KVP & Co.
Lean, Kaizen, KVP & Co. – Begriffe voller Missverständnisse
Weitere Inhalte auf LeanNetwork

Quality Services & Wissen GmbH - Carmen Weber
Ich arbeite bei der Quality Services & Wissen GmbH, die zusammen mit der OPEX Training & Consulting GmbH und KVP Lösungen im Bereich Qualitätsmanagement und der Prozessoptimierung bietet. Mein Verantwortungsbereich umfasst Marketing, Vertrieb, die Kundenbetreuung und Social Media. Wir bieten umfassende Expertise in den Bereichen Qualitätskontrolle, Prozessanalyse, Risikomanagement...

Janine Kreienbrink
Ich beschäftige mich seit Jahren damit, vom Kunden aus zu denken und interdisziplinäre Teams und interne Prozesse an den Kundenwünschen auszurichten.

Franziska Köppe
Mein Engagement fokussiert sich auf kleine und mittelständische Firmen (Handwerk, Industrie, Dienstleistungen), Wissenschaften, Kunst & Kultur – die mit Herzblut und Sinn gestalten wollen. Zentrale Elemente sind Humanismus (Menschlichkeit), Aufklärung (Selbst-Steuerung und Eigenverantwortung) und Freiheit (Informationsfreiheit, Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit, und vieles mehr). Das...