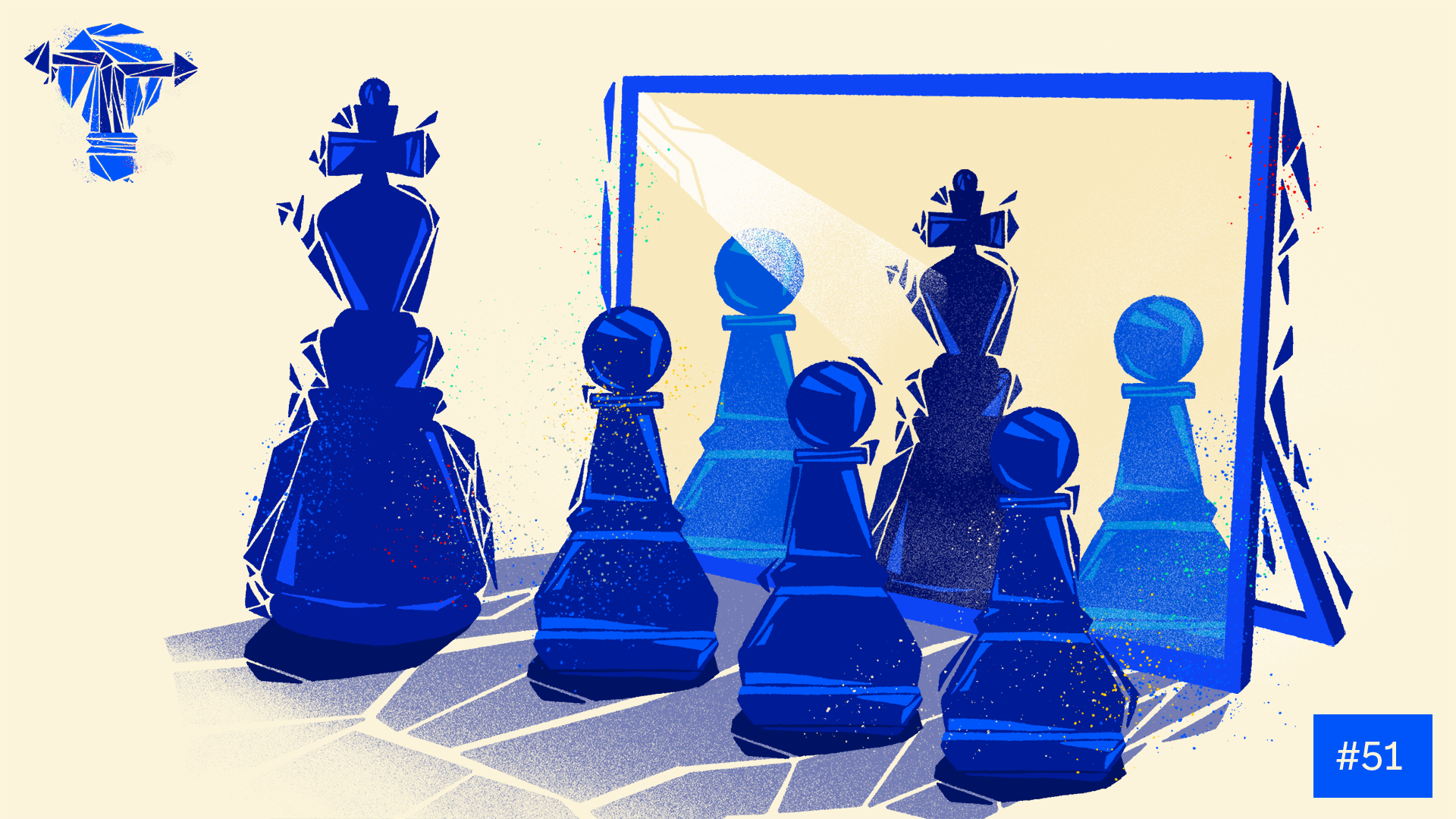
Unsere Neigung zu Isomorphismus
Oder: Warum Ähnlichkeit gefährlich ist
In Vorbereitung auf ein Gespräch mit Julia Hautz, Professorin für strategisches Management an der Universität Innsbruck, ist mir in ihrem Buch „Open Strategy“ ein sehr interessanter Aspekt der Unternehmenswelt aufgefallen: Isomorphismus. Wobei „isomorph“ so viel bedeutet wie „von gleicher Gestalt oder Struktur“.
Schon der Amerikaner Robert B. Cialdini, ein emeritierter Professor für Psychologie und Marketing an der Arizona State University, hat sich jahrzehntelang mit den Faktoren beschäftigt, die zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen und für unser Verhalten relevant sind (im Positiven wie im Negativen). Dabei hat er festgestellt, dass Ähnlichkeit ein sehr wichtiger Faktor ist, unabhängig davon, um welche Dimension es sich handelt – seien es Ansichten, Hobbys, Herkunft oder Lebensstil. In Experimenten reichte schon ähnliche Kleidung aus, um die Zustimmungsraten bei den unterschiedlichsten Fragen bis zu 30 Prozent zu erhöhen.
Oder wie der Journalist und Fernsehmoderator Robert Lembke mal gesagt haben soll:
„Was wir an anderen bewundern, ist ihre Ähnlichkeit mit uns.“
Da ist es nicht verwunderlich, wenn auch Unternehmen in einem ähnlichen Umfeld dazu tendieren, sich anzugleichen – in einer Art institutionellem Isomorphismus.
So greifen Unternehmen bei der Entwicklung von Strategien gern auf ähnliche Muster zurück, sei es, indem sie sich an erfolgreichen Wettbewerbern orientieren, an anerkannten Best Practices oder an Benchmarks ihrer Branche. Darüber hinaus gibt es auch relevante Rahmenbedingungen, die eine Angleichung fördern, zum Beispiel übliche Standards, gesetzliche Regelungen oder gesellschaftliche Erwartungen.
In diese Kategorie fallen auch bestimmte Ausbildungsschmieden, die es in vielen Branchen gibt und häufig ähnlich ausgebildete Manager und Experten hervorbringen, die später dann natürlich die selben Konferenzen und Weiterbildungen besuchen.
Das Ergebnis sind Strategien, die sich immer stärker ähneln und langweilig sind. Meine Erfahrung aus vielen Beratungsprojekten ist, dass Unternehmen, die nur ihren Wettbewerbern folgen, früher oder später große Probleme bekommen. Wer immer nur darauf schaut, was die Konkurrenz macht, schaut schnell in die Röhre, denn das führt Unternehmen leicht in einen ruinösen Preiswettbewerb.
Anders formuliert:
„Gehe nicht den Weg der Wettbewerber, denn der führt nur dahin, wo andere schon sind.“
Ohne Differenzierung ist ein Unternehmen vom Aussterben bedroht, das wusste schon der amerikanische „Positionierungspapst“ Jack Trout. Sein etwas martialisches, aber sehr klares Erfolgsrezept lautete:
„Differentiate or die.“
Klar: Jeder kann sich von anderen unterscheiden, ohne auch nur eine Einheit zu verkaufen. Die hohe Kunst besteht daher darin, ein differenzierendes Angebot zu machen, das tatsächlich ein Bedürfnis befriedigt – oder sogar erst schafft. Ein Unternehmen, das seinen Kunden ein „Mehr“ bietet, wird von ihnen auch ein „Mehr“ bekommen, denn dann kann es einen höheren Preis verlangen. Philip Kotler, über viele Jahrzehnte Professor an der Kellogg School of Management an der Northwestern University und weltweit vielleicht die Koryphäe in Sachen Marketing, hat dies einmal auf eine sehr prägnante, treffende und einfache Formel gebracht:
„More for more“
Michael Porter, einer der bekanntesten Professoren der Harvard Business School und weltweit anerkannter Experte für Strategien und Wettbewerbsfähigkeit, bestätigt diese Erkenntnis und formuliert sie wie folgt:
„Eine Strategie, die zu einem klaren Wettbewerbsvorteil führt, besteht darin, anders zu sein.“
Das Problem dabei ist: Wer sich ständig innerhalb gleicher Strukturen, Gesetzmäßigkeiten und Denkmuster bewegt, für den ist es sehr schwierig, einzigartige oder gar disruptive Strategien zu entwickeln. Zugleich ist es wichtig, mit dem Neuen am Vertrauten und Vorhandenden anzudocken, weil sonst das Verständnis und damit die Akzeptanz ausbleiben. Cornelia Hegele-Raih brachte dieses Dilemma einmal vor Jahren im Harvard Business manager so auf den Punkt:
„Neues ist nur in den Kategorien des Bekannten fassbar. Was außerhalb dessen liegt, wird schlichtweg nicht verstanden oder wahrgenommen.“
Die klare Empfehlung von Professorin Julia Hautz ist, externe Akteure einzubeziehen, die nicht durch die eigenen Strukturen „geblendet“ sind. Eine Strategie sollte nicht in einem elitären Kreis von Topmanagern entwickelt werden, sondern unter offener Einbeziehung unterschiedlichster Personengruppen, die zudem am besten nicht nur aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch aus dem Marktumfeld stammen.
„Völlig unerwartet kommt es zu einem Heureka-Moment, der ausgelöst wird durch das Aufeinandertreffen von Ideen. Diese Ideenkollision entsteht, wenn Wissen aus unterschiedlichen Fachgebieten Grenzen überschreitet.“
Nach verschiedenen Studien lassen sich etwa 30 bis 50 Prozent aller Entdeckungen auf Serendipität zurückführen – ein Phänomen, das Christian Busch, Autor des Bestsellers " Erfolgsfaktor Zufal (unser Gespräch „Glücksfall Zufall“) und neuerdings Professor of Clinical Management and Organization an der University of Southern California in Los Angeles, wie folgt beschreibt:
„(Serendipität) lässt sich am besten definieren als unerwartetes Glück, das sich aus ungeplanten Ereignissen ergibt, in denen unsere Entscheidungen und unser Handeln zu positiven Ergebnissen führt.“
Zu den bekanntesten Beispielen für Entdeckungen, die auf diese Weise in die Welt kamen, gehören Viagra, Penicillin, Post-its, Röntgenstrahlen oder Sekundenkleber. Auch die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492 geht im Grunde auf Serendipität zurück. Kolumbus suchte bekanntlich etwas anderes, den Westweg nach Indien, und fand erst dadurch den „neuen“ Kontinent.
Können wir Serendipität als Fähigkeit durch eigenes aktives Handeln erzeugen? Buschs klare Antwort: Ja. So habe schon Seneca den richtigen Punkt gesetzt, dass Glück dann entstehe, wenn die richtige Vorbereitung auf eine Gelegenheit treffe.
„Sobald wir erkennen, dass es sich bei Serendipität nicht nur um bloßen Zufall handelt, der uns einfach so begegnet, sondern um einen Prozess des Erkennens und Verbindens von Punkten, beginnen wir Brücken zu sehen, wo andere Gräben sehen.“
Die Vielfalt der Perspektiven ermöglicht es uns, neue Verbindungen zu entdecken und uns im Mehrwert, den wir für unsere Kunden schaffen, nachhaltig von anderen Marktteilnehmern zu differenzieren.
Wann haben Sie zuletzt etwas anders gemacht als der Rest?
Weitere Inhalte
Kennst Du schon LeanTransferLearning?
-
Wissen — gemeinsam erwerben und bei der Anwendung ausbauen
-
Transfer — begleitete Umsetzung im betrieblichen Alltag
-
Praxis — direkter ROI durch schnelle Nutzung im eigenen Umfeld

Details zur Vorgehensweise (1) - Online-Lern-Modul 7
Im Detail umfasst die Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse eine Vielzahl einzelner Schritte, die aufeinander aufbauen und Abhängigkeiten bilden. Diese Details werden in zwei getrennten Blöcken …

Online-Lern-Modul 3: Die drei Mu´s
Ein zentrales Element des Lean-Denkens ist das Verständnis von "Verschwendung". Dabei unterscheidet man zunächst zwischen den Verlustarten Muri und Mura. Diese führen häufig zur dritten …
Weitere Inhalte auf LeanNetwork

Lean „einfach“ oder „einfach Lean“
Alle sagten: „Das geht nicht.“ Dann kam einer, der wusste nichts davon und hat es gemacht!

Berater - Folge 5
Im Folgenden hören Sie einen weiteren Mitschnitt eines Interviews mit dem CEO der WMIA Inc., Herrn Dr. h.c. Any Nemo und seinem Berater.Wir befinden uns heute in der Marmorhalle beim Empfang …

Strategiegespräch - Folge 9
Das folgende Interview bzw. die haarsträubende Beschreibung einer Vorstandssitzung zur Strategie im erweiterten Führungskreis bei WMIA Inc., dem größten und mehr oder weniger erfolgreichsten …

Lean vs. Industrie 4.0 – ein vermeintlicher Konflikt löst sich in Luft auf!
Am 19.2. war es so weit. Über 100 Experten, Freaks, Vordenker und Medienvertreter sind der Einladung zur NextAct – Initiative für die Transformation der NextEconomy gefolgt.



Kommentare
Bisher hat niemand einen Kommentar hinterlassen.
Kommentar schreiben
Melde Dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Teilen